Rückbaubürgschaft

Mit einer Rückbaubürgschaft für innovative Energieprojekte kommen Sie Ihrer gesetzlich geregelten Rückbauverpflichtung nach.
Wo große Wind- oder Solarparks entstehen oder Biomasse-Anlagen realisiert werden, pachten die Betreiber meist das Grundstück. Geht die Nutzungsdauer der Anlage zu Ende oder wird der Betrieb aus anderen Gründen eingestellt, muss die Fläche in ihren früheren Zustand zurückversetzt werden. Die Rückbaubürgschaft stellt sicher, dass die finanziellen Mittel dafür vorhanden sind.
Rückbaubürgschaft: Einfach erklärt
Diese und weitere Fragen beantwortet unsere Spezialistin für Bürgschaften in unserem Video.
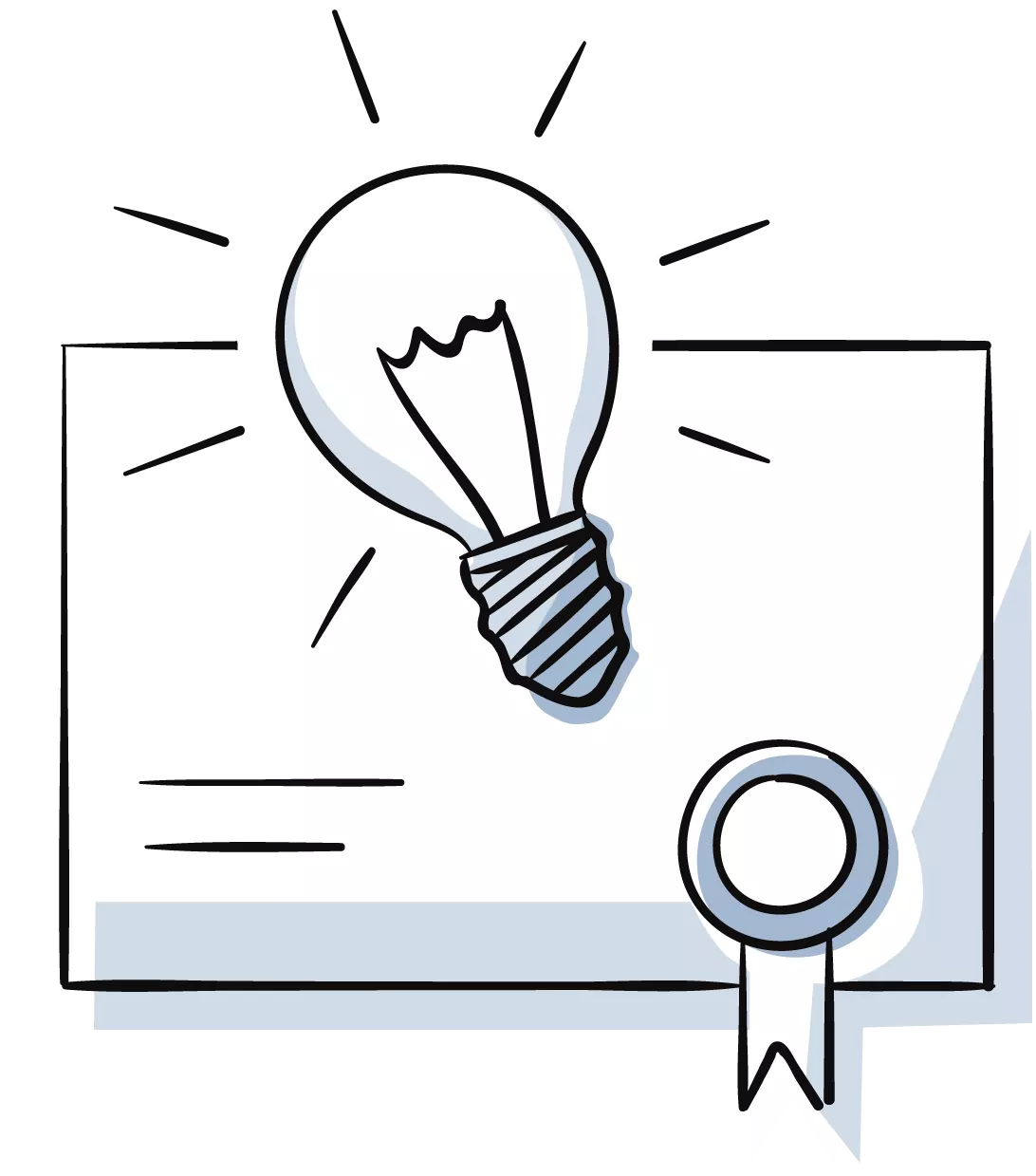
Was ist eine Rückbaubürgschaft?
Wer eine Windkraftanlage, eine Photovoltaik-Anlage oder ein System zur Nutzung von Biogas errichten will, pachtet oftmals ausgedehnte Flächen und muss das Bauvorhaben entsprechend genehmigen lassen. Die Beantragung der Genehmigung von Wind- oder Solaranlagen ist ein komplexer Prozess, zu dem auch eine Sicherheit für den späteren Rückbau entsprechend §35 Abs.5 BauGB gehört. Sie muss bereits bei der Antragstellung nachgewiesen werden. Mit einer sogenannten Rückbaubürgschaft ist sichergestellt, dass die Anlage nach der Einstellung der Nutzung durch den Pächter vollständig beseitigt wird – einschließlich der Fundamente und sämtlicher Bodenversiegelungen.
Eine Sicherheit für den Fall der Insolvenz des Pächters kann auf unterschiedliche Weise beigebracht werden:
Eine Sicherheit für den Fall der Insolvenz des Pächters kann auf unterschiedliche Weise beigebracht werden:
in Form einer Bürgschaftsversicherung, durch eine Bankbürgschaft, durch das Hinterlegen von Sicherheiten, über die Eintragung von Rechten oder mit einem Festgeldkonto, auf das die Baubehörde bei Bedarf Zugriff hat.
Die Entscheidung für eine Rückbaubürgschaft über eine Versicherung hat den Vorteil, dass die Liquidität des Pächters nicht eingeschränkt wird.
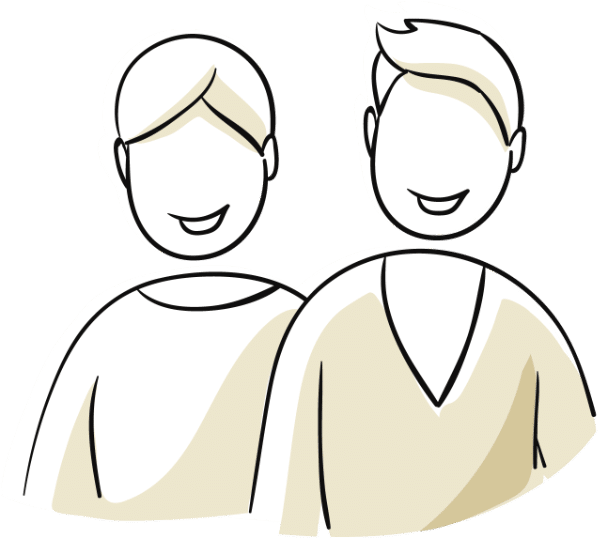
Für wen ist die Rückbaubürgschaft sinnvoll?
Alle, die den Bau einer Anlage für die Erzeugung „grüner“ Energien planen und die erforderliche Baugenehmigung beantragen wollen, benötigen eine Rückbaubürgschaft Windenergie, Photovoltaik oder Biogas. Über den Versicherer ist eine solche Bürgschaftsversicherung bei entsprechender Bonität des Antragstellers rasch bearbeitet und ausgefertigt. Das beschleunigt die Beantragung der Baugenehmigung, spart Zeit und schont die Liquidität, da die Kreditlinie bei der Bank durch die Bürgschaft nicht berührt wird.
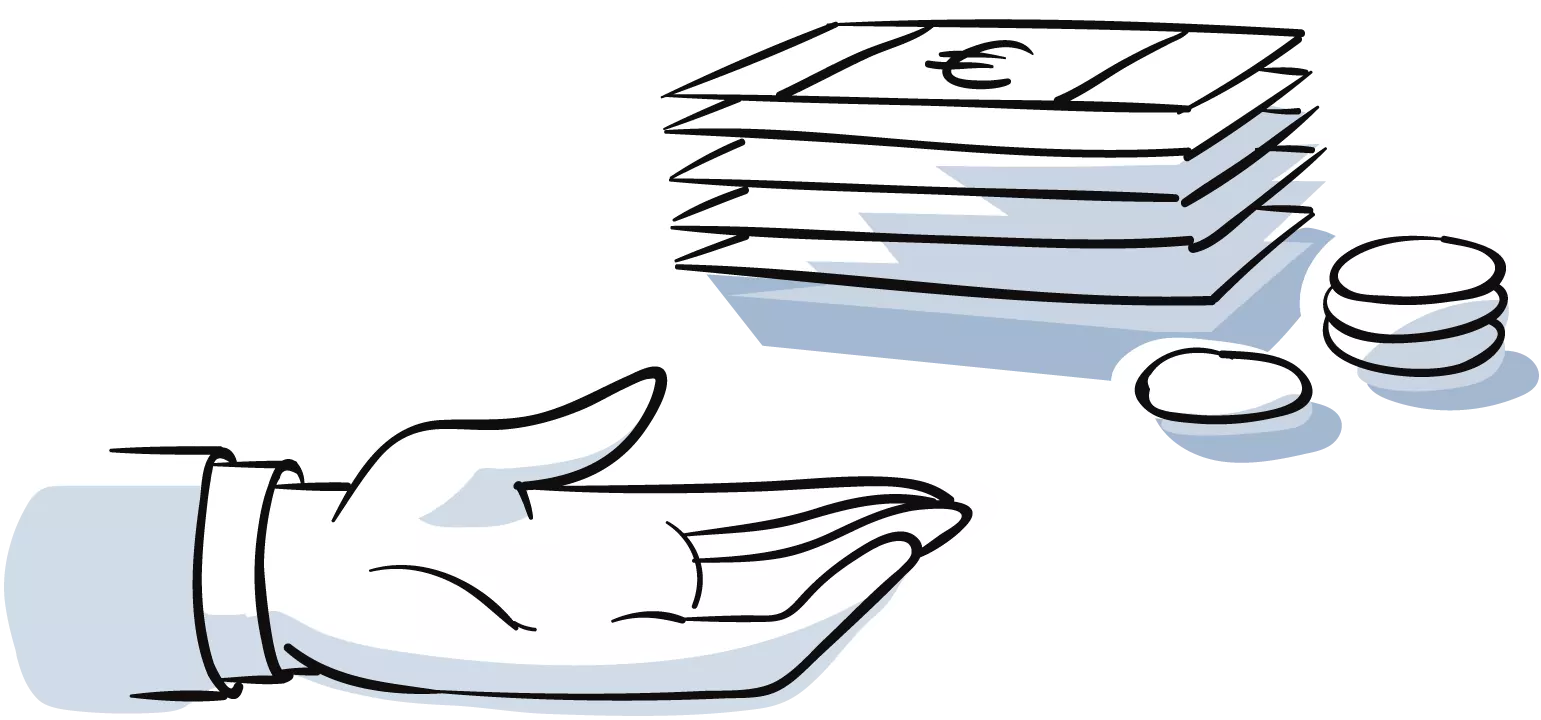
Praxisbeispiel einer Rückbaubürgschaft
Die Solar Muster Power AG möchte einen Beitrag zur Energiewende leisten und plant die Einrichtung einer großflächigen Photovoltaik-Anlage. Gerade in Zeiten starken Wachstums belasten die nötigen Sicherungsleistungen die Liquidität und damit die Finanzierungskonditionen der Firma. Durch Rückbaubürgschaften reduziert sie ihre Verpflichtungen gegenüber der Hausbank. Eine beschleunigung der Genehmigungsprozesse und eine Entlastung bei der Bank ist die Folge.
Das Unternehmen kann mit einer beschleunigten Bearbeitung der Baugenehmigung rechnen und dank verbleibender Liquidität nach der Bewilligung mit der Umsetzung beginnen und weitere Investitionen tätigen.
Die Behörde und der Grundstückseigentümer sehen eine wesentliche Voraussetzung, nämlich die Gewährleistung des Rückbaus, erfüllt.
Der Versicherer bürgt für den Fall einer Insolvenz für den vollständigen Rückbau der geplanten Anlage – gegen die Zahlung regelmäßiger Beiträge.
Rückbaubürgschaft auf einen Blick
Bürgschaften
ab 5.000 EUR
Bürgschaftsempfänger
Baugenehmigungsbehörde
Besonders geeignet für
Alle Unternehmen die in den Ausbau alternativer Energieen investieren und Anlagen bauen oder planen.
Das sagen unsere Kunden über uns

Mit der SHL Gruppe haben wir einen Partner, der uns bereits seit 2004 begleitet, unser Geschäftsmodell versteht und seitdem aktiv unser Sicherheitspaket sowie die entsprechenden Prozesse gemeinsam mit uns weiterentwickelt. Immer mit dem Ziel, das bestmögliche für uns, unsere Baupartner und Kunden herauszuholen. Eine offene, ehrliche und sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir sehr schätzen.
Benjamin Dawo
Geschäftsführer der Town & Country Haus Lizenzgeber GmbH

Durch die kompetente Beratung und Abwicklung konnten wir mit der SHL schnell eine passende Lösung finden. Wir freuen uns, dass wir einen Geschäftspartner an unserer Seite haben, der unsere Konzepte und Wünsche versteht und gemeinsam mit uns umsetzen kann.
Ivo Wissler und Dr. Love Edquist
Die Gründer & Geschäftsführer der Küchenheld GmbH

Die SHL unterstützt uns zielorientiert bei der Erkennung und Absicherung von Risiken, um geeignete und tragfähige Versicherungslösungen zu finden. Es ist gut einen Partner an der Seite zu haben, der den innovativen Weg zur autonomen Transportlogistik mit uns gemeinsam beschreitet.
Bene Fried
Business Development bei der FERNRIDE GmbH
Rückbaubürgschaft: Kosten und Verfahren
Für Betreiber von Anlagen für die nachhaltige Energieerzeugung sind Kosten mit einer Rückbaubürgschaft verbunden. Diese fallen jedoch meist geringer aus oder reduzieren nicht die Liquidität wie andere Sicherheitsformen. Die Höhe der Beiträge für eine Rückbaubürgschaft ist abhängig von verschiedenen Faktoren:
Eine Rückbaubürgschaft über einen Avalkredit bei einer Bank wird auf die Kreditlinie des Unternehmens voll angerechnet und mindert so den finanziellen Spielraum.
Eine Rückbaubürgschaft Windkraft über einen Versicherer greift die Kreditlinie nicht an und lässt sich dank vorab vereinbarter Prämien ohne sonstige Gebühren und Kosten voll und ganz in die eigene Planung einbeziehen
Warum die Rückbaupflicht?
Wer ein Projekt wie einen Windpark oder einen Solarpark realisiert, benötigt dazu meist eine beträchtliche Fläche – und mit dem Ausbau der Anlagen erfolgt ein sichtbarer Eingriff in das Landschaftsbild. Die Rückbaupflicht besagt, dass die gesamte Anlage nach der Einstellung des Betriebs demontiert und das Grundstück in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden muss.
Das Betriebsende ist gegeben, wenn
Die Rückbaubürgschaft wird hinterlegt, um sicherzustellen, dass ein Pächter dieser Verpflichtung nachkommt – erst mit dem Abschluss des Rückbaus kann er die Bürgschaftsurkunde zurückfordern und an den Versicherer zur Ausbuchung weitergeben.
Die Verpflichtung zum Rückbau umfasst nicht nur den Abbau der eigentlichen Anlage, sondern auch die Beseitigung von Zufahrten, Fundamenten und sonstigen Bodenversiegelungen.
Ist zusätzlich die Wiederherstellung der ursprünglichen Bepflanzung Teil der Vereinbarung, benötigen Pächter außerdem eine sogenannte Rekultivierungsbürgschaft.
Unkomplizierte Pflichterfüllung mit Rückbaubürgschaft
Bürgschaften haben viele Vorteile: bei guter Bonität und Überreichen aller erforderlichen Unterlagen können sie meist recht schnell beantragt werden, sie sind in der Geschäftswelt allgegenwärtig und anerkannt und können große Summen absichern, ohne dass die Liquidität des Unternehmens eingeschränkt wird.
Kritaya Moschna, Spezialistin Kautionsversicherungen
Rückbaubürgschaft vom Versicherer
Die Errichtung großflächiger Wind- oder Solarparks ist aufwendig – die spätere Rückführung der Flächen in den Urzustand ebenfalls. Mit einer Rückbaubürgschaft Windenergie-Projekte abzusichern, gehört zu den Voraussetzungen für die Baugenehmigung.
Da die Bürgschaft von einem spezialisierten Versicherer rasch beigebracht wird, müssen Unternehmen weder ihre Kreditlinie bei der Hausbank angreifen noch mit einer Verzögerung der Bewilligung rechnen. Stattdessen fallen lediglich Prämien zu günstigen Konditionen an.
Im Gespräch mit einem Versicherungsmakler erfahren Interessenten mehr und erhalten durch ein Rückbaubürgschaft Muster eine Vorstellung von den Abläufen und Kosten.
Möchten Sie eine Beratung?
Wir beraten Sie gerne bei der Wahl der passenden Bürgschaft. Sie können dazu ganz bequem Ihren Wunschtermin online buchen.

Tanja Vuksanovic
Teamleitung Bürgschaftsversicherungen

Melanie Larcher
Spezialistin Bürgschaftsversicherungen
Häufige Fragen zur Rückbaubürgschaft (FAQ)
Die Bürgschaft stellt sicher, dass Anlagen für die Erzeugung nachhaltiger Energien nach dem Einstellen des Betriebs ordnungsgemäß zurückgebaut werden, selbst wenn der Betreiber des Windparks oder des Photovoltaikprojekts inzwischen insolvent ist und seiner Verpflichtung nicht nachkommen kann.
Mit einer Rückbaubürgschaft Windenergie (und verwandte Projekte) beschleunigen Unternehmen die Abwicklung der Baugenehmigung und behalten ihre Liquidität für die praktische Umsetzung der geplanten Anlage.
Wind- und Solarparks oder größere Biogas-Anlagen werden häufig auf gepachteten Flächen errichtet und stellen eine deutliche Veränderung des Landschaftsbildes dar. Sowohl der Grundstückseigner als auch die Gemeinde müssen sich darauf verlassen können, dass nach Betriebsende alle Bestandteile der Anlage vollständig zurückgebaut werden.
Planer haben die Wahl: Akzeptabel ist das Hinterlegen der Bürgschaftssumme oder vergleichbarer Sicherheiten, ein Bankkredit oder eine Kautionsversicherung zu günstigeren Konditionen. Interessenten können bei einem spezialisierten Versicherungsmakler die Angebote der Versicherer einholen und vergleichen und sich überdies fachlich beraten lassen.

